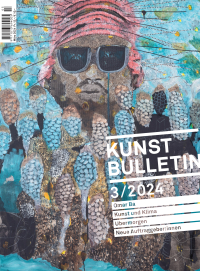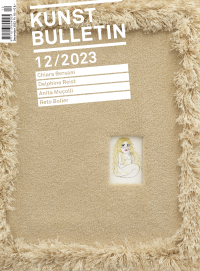Am 27. Mai 1806 wurde der Schweizerische Kunstverein SKV als «Gesellschaft Schweizerischer Künstler und Kunstfreunde» in Zofingen gegründet. In seiner wechselhaften Geschichte hat er sich immer erfolgreich für die visuellen Künste - in den Zentren und vor allem auch in der Peripherie - eingesetzt und so einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt der Schweiz geleistet.