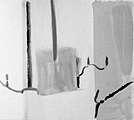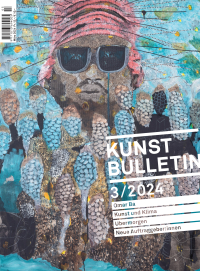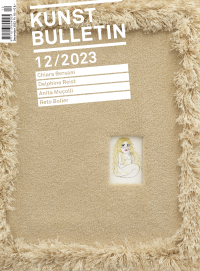Im süssen Kostüm viktorianischer Silhouetten kommt sie verführerisch daher, die Kunst der Kara Walker: Doch ihre Bilder konfrontieren uns in fast grotesker Direktheit mit jenen Szenen zwischen Herr und Sklavin, die uns die Geschichten jener Zeit verschweigen. Dennoch geht es der Künstlerin nicht um eine historische Korrektur, sondern um ihre eigene Erfahrung.