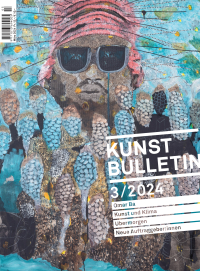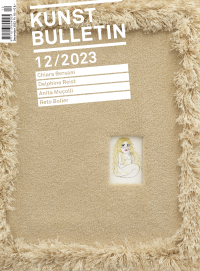En 1995, l’artiste français Brice Dellsperger veut filmer une inconnue qui se fait attaquer par surprise en sortant d’un ascenceur de la galerie marchande Nice Etoîle. Par crainte de voir l’attaque mal tourner, il décide de jouer la victime. «Make up and dress» et les portes s’ouvrent sur l’artiste perruqué qui se fait passer à tabac par des mains expertes. Cette scène est empruntée au film «Dressed to Kill» de Brian de Palma (1984). Elle marque le début d’une série de remakes qui portent tous le titre «Body Double». Les séquences choisies sont empruntées par exemple à «Psychose», «Obsession», «My Own Private Idaho» ou «Le Retour du Jedi».