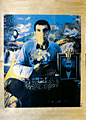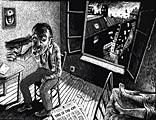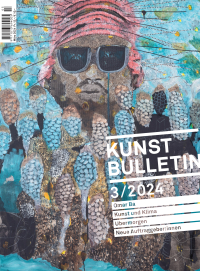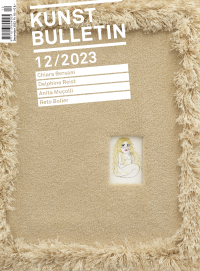Als Klangkünstler bestellt Andres Bosshard ein Feld, das an den Schnittstellen von Musik, Bildender Kunst, Gestaltung und Architektur angesiedelt ist. Ein Zwischenreich, das auf zentrale Funktionen, Bedürfnisse und Potenziale der menschlichen Wahrnehmung ausgerichtet ist; eine Kunstform, die mitunter unsichtbar bleibt - aber keineswegs allein das Ohr, sondern alle Sinne ansprechen will.