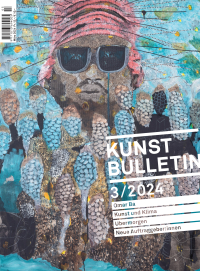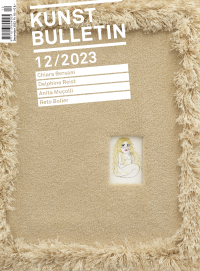Angesichts der Globalisierung und der anstehenden Osterweiterung der EU liegt es, im wahrsten Sinne des Wortes, nahe, die (Avantgarde-)Kulturen von West
und Ost in einem Dialog zu vereinen. Der österreichische Künstler Marko Lulic, dessen Eltern noch im ehemaligen Jugoslawien geboren sind, unternimmt mit seinen ästhetischen Recherchen genau dieses.