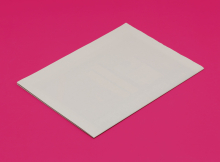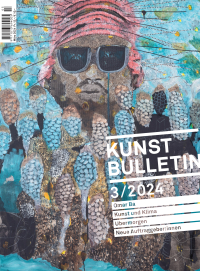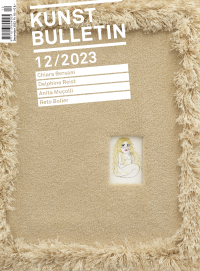Die Fakten liegen offen: Bruce Nauman, 1941 geboren, hat unter anderem das Tun des Künstlers in den Status des Werks gehoben. Mit der anhaltenden Deklination elementarer Gesten fand er früh Anschluss an die amerikanische wie an die europäische Avantgarde. Heute ist er – sofern es das gibt – einer der Grössten. Was heisst das eigentlich?