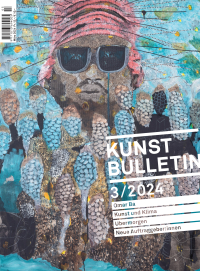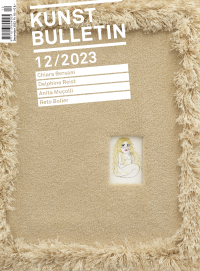Blumen und Fragen - beide können sich entfalten, je länger, je schöner. Nach London und Paris zeigen Peter Fischli und David Weiss im Kunsthaus Zürich ihr Herbarium aus fast 30 Jahren Kooperation. In Paris traf ich die Künstler zum Gespräch über ein Werk, das bei allem Spiel mit den grossen Fragen das Individuum und dessen ganz singuläre Erfahrungswelt ins Zentrum stellt.