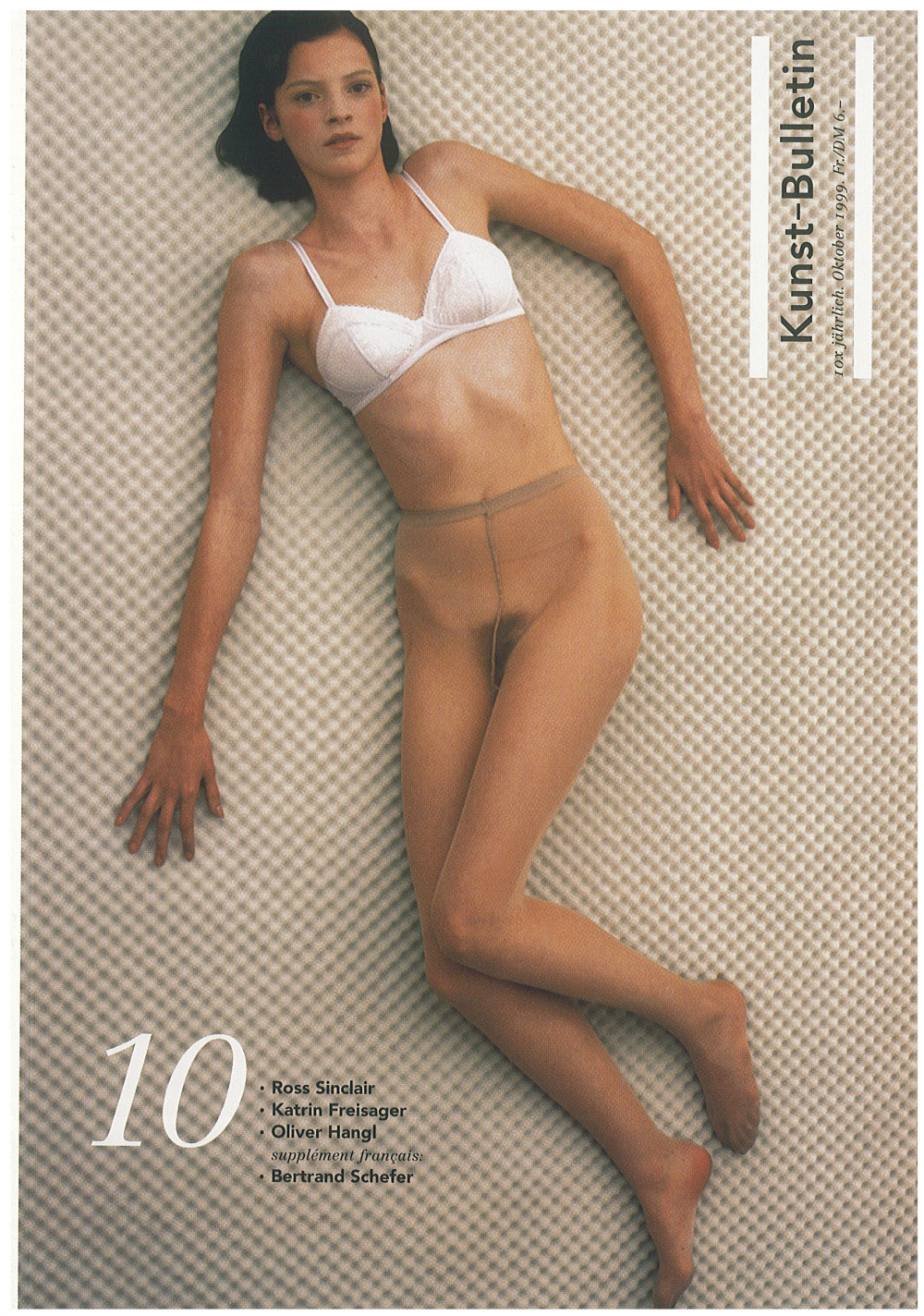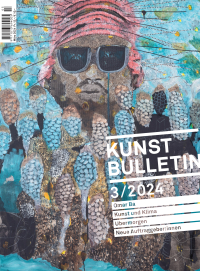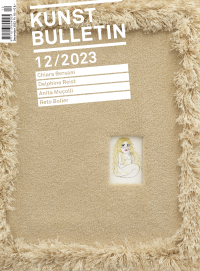Das vielbesungene Crossover ist ein wenig in die Jahre gekommen. Dass dieser Ansatz High and Low, Kunst und Leben, Galerie und Club miteinander kurzzuschliessen aber immer noch so spannend wie problematisch ist, dies ist nicht zuletzt der Arbeit des Schotten Ross Sinclair ables- und abhörbar.